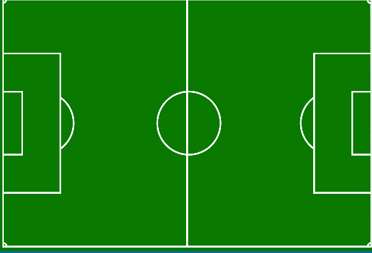Klima und Ernährung: eine Nachlese

Die Veranstaltung ist Teil der aktuell laufenden Online-Reihe „Die Kammer kommt in die Region“. Über die Rolle von Grünland und Wiederkäuern für die Zukunft der Welternährung berichtete Prof Wilhelm Windisch, Ordinarius für Tierernährung an der TU München und räumte dabei mit den gängigsten Narrativen auf, die zu diesem Thema in vielen Köpfen kursieren. Zum Beispiel dass Nutztiere Nahrungsmittelkonkurrenten sind.
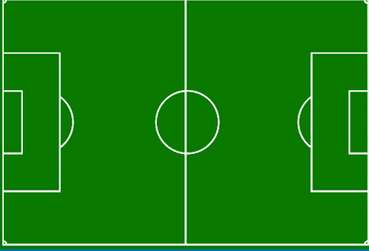
Mehr Menschen, weniger Boden
Aktuelle Entwicklungen lassen vermuten, dass sich die Weltbevölkerung bis 2050 beinahe verdoppelt. Die rasante Entwicklung im Bodenverbrauch verschärft das Zukunftsszenario zusätzlich. Neben der Klimakrise ist die Verknappung des Bodens eine der größten Bedrohungen der Menschheit.
Prof. Windisch verdeutlicht die Situation anhand eines Fußballfeldes. Ein Fußballfeld mit 7.400 Quadratmeter ernährt aktuell drei Menschen. Im Jahr 2050 steigt diese Zahl auf fünf. Ackerfähig sind dabei nur die Strafräume. Der überwiegende Teil ist für den Menschen nicht essbare Biomasse. Wiederkäuer können diese nicht essbare Biomasse verwerten. Das bedeutet: wir brauchen die Wiederkäuer für die Lebensmittelproduktion, denn sie können nicht essbare Biomasse nicht nur fressen, sie verwandeln sie auch in hochwertige Lebensmittel für den Menschen. Und der Rest geht zurück in den Kreislauf, als hochwertiger Wirtschaftsdünger, der punktgenau zum Pflanzenwachstum eingesetzt werden kann.
Prof. Windisch verdeutlicht die Situation anhand eines Fußballfeldes. Ein Fußballfeld mit 7.400 Quadratmeter ernährt aktuell drei Menschen. Im Jahr 2050 steigt diese Zahl auf fünf. Ackerfähig sind dabei nur die Strafräume. Der überwiegende Teil ist für den Menschen nicht essbare Biomasse. Wiederkäuer können diese nicht essbare Biomasse verwerten. Das bedeutet: wir brauchen die Wiederkäuer für die Lebensmittelproduktion, denn sie können nicht essbare Biomasse nicht nur fressen, sie verwandeln sie auch in hochwertige Lebensmittel für den Menschen. Und der Rest geht zurück in den Kreislauf, als hochwertiger Wirtschaftsdünger, der punktgenau zum Pflanzenwachstum eingesetzt werden kann.
Zum Vergleich: Vegane Lebensmittelproduktion
Bei der Produktion von einem Kilo veganem Lebensmittel werden vier Kilo nicht essbare Biomasse in Form von Nebenprodukten wie Stroh oder Zwischenfrüchten erzeugt. Ein Kapital, das es gilt im Kreislauf zu halten. Die entzogenen Nährstoffe sollten wieder zurückgeführt werden. Alles einfach auf das Feld zu geben, ist nicht effizient. Besser ist eine Vergärung zu Biogas. Das bringt Gärreste, die als Dünger verwendet werden können. Oder noch besser: die Verfütterung an Nutztiere. Die Kombination der Produktion veganer Erzeugnisse mit der Verfütterung der Nebenprodukte an Nutztiere erzeugt ein Maximum an Lebensmitteln aus derselben Biomasse bei weitgehend unveränderten Emissionen.
Es macht also keinen Sinn die Nutziere abzuschaffen, denn werden sie bei der Nahrungsmittelproduktion klug eingesetzt, erzeugen sie zusätzliche Lebensmittel und fördern die Pflanzenproduktion.
Es macht also keinen Sinn die Nutziere abzuschaffen, denn werden sie bei der Nahrungsmittelproduktion klug eingesetzt, erzeugen sie zusätzliche Lebensmittel und fördern die Pflanzenproduktion.
Mythos: Die Klimakillerkuh und das Methan
Gemeinhin wird verbreitet, dass die Kuh durch ihren Methanausstoß die Erdatmosphäre anheizt und damit schädlich für das Klima sei. Die Methan-Bildung ist für die mikrobiellen Umsetzungen im Pansen unverzichtbar. Sie schützt vor Störungen der Fermentation. Dabei ist das Methan aber sehr kurzlebig, die „Klimaschuld“ ist nach zehn bis 20 Jahren weitgehend getilgt. Ganz im Gegensatz zum langlebigen CO2, das seit der Industrialisierung kumuliert. Wird der Kreislauf und die Speicherfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden in der Klimarechnung ebenfalls mitberücksichtigt, dann zeigt sich ein neues Bild. Umweltwirkungen durch die Nutztierhaltung entstehen erst beim gezielten Anbau von zusätzlichem Futter oder durch die Umwidmung von essbaren Pflanzenkulturen zu Tierfutter.
Alternativen zur Nutztierhaltung?
Mit Augenmaß ist auch die Entwicklung des Kunstfleisches zu betrachten. Klar es muss kein Tier sterben, es gibt keine Konflikte mit dem Tierwohl und keine Verluste am Schlachthof. Aber, so Prof. Windisch, Kunstfleisch ist auch nur ein „Nutzier“, das höchstwertiges „Futter“ (Glucose, Aminosäuren...) braucht. Es ist ein Nahrungskonkurrent zum Menschen. In Anbetracht der oben genannten Vorteile von Nutztieren ist es erst dann eine Alternative, wenn es mit nicht essbarer Biomasse „gefüttert“ werden kann.
Prof. Windisch beschreibt das Szenario für die Zukunft: „Eine einseitig „vegane“ Landwirtschaft ist weder nachhaltig noch klimaschonend, eine einseitig intensive Tierhaltung auch nicht. Erst in der richtigen Kombination erreicht die Umwelt- und Klimawirkung der Landwirtschaft ihr Minimum (Kreislaufwirtschaft auf Basis der unvermeidlich anfallenden, nicht essbaren Biomasse). Dabei sind die Wiederkäuer die wichtigsten Nutztiere der Kreislaufwirtschaft. Bei Verzicht auf sehr hohe Leistungen erzeugen sie höchstwertige Lebensmittel ohne Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Dies wiegt die (ohnehin geringe) ‚Methanbürde‘ der Milch bei weitem auf.“
Prof. Windisch beschreibt das Szenario für die Zukunft: „Eine einseitig „vegane“ Landwirtschaft ist weder nachhaltig noch klimaschonend, eine einseitig intensive Tierhaltung auch nicht. Erst in der richtigen Kombination erreicht die Umwelt- und Klimawirkung der Landwirtschaft ihr Minimum (Kreislaufwirtschaft auf Basis der unvermeidlich anfallenden, nicht essbaren Biomasse). Dabei sind die Wiederkäuer die wichtigsten Nutztiere der Kreislaufwirtschaft. Bei Verzicht auf sehr hohe Leistungen erzeugen sie höchstwertige Lebensmittel ohne Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Dies wiegt die (ohnehin geringe) ‚Methanbürde‘ der Milch bei weitem auf.“
Die Kraft des Regionalen
Ernährungswissenschaftlerin Katrin Fischer MSc, BSc ging am selben Abend in ihrem Referat auf das Thema „Die Kraft des Regionalen – Mythen unserer Ernährung“ ein: „Viele Menschen reden über Ernährung, aber wenige kennen sich beim Essen wirklich aus. Menschen kennen die Lebensmittel großteils nur noch aus dem Supermarkt. Den Bezug zu den Lebensmitteln haben nur noch wenige“, so Fischer.
Täglich treffen Menschen 200 Entscheidungen rund ums Essen. Dabei gibt es eine Gruppe, für die zählt nur, dass sie etwas zu essen haben. Sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Die andere Gruppe macht ihre Kaufentscheidung von Gesundheit und Nachhaltigkeit abhängig.
Täglich treffen Menschen 200 Entscheidungen rund ums Essen. Dabei gibt es eine Gruppe, für die zählt nur, dass sie etwas zu essen haben. Sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Die andere Gruppe macht ihre Kaufentscheidung von Gesundheit und Nachhaltigkeit abhängig.
„Gute“ und „böse“ Lebensmittel
Immer mehr Lebensmittel bekommen ein Image und werden eingeteilt in „gut und böse“ oder „gesund und ungesund“. Auch von Ersatzprodukten wird oft geredet. Doch es handelt sich um Imitate, wie zum Beispiel ein Pflanzendrink als Ersatzprodukt für die Milch. Ein Pflanzendrink wie Hafer- oder Mandelmilch besteht zu einem großen Prozentsatz aus Wasser. Unsere Milch kann in kleinen Schritten, wie dem zusetzen von Bakterien, fermentieren oder einer Eiweißgerinnung in unterschiedlichste Milchprodukte veredelt werden. Ein Pflanzendrink bietet diese Produktvielfalt nicht. Daher kann hier nicht vom gleichen Lebensmittel gesprochen werden, so die Ernährungswissenschaftlerin.
Medien, Berichte, Bücher und andere Informationsquellen transportieren viele negative Aspekte über die Lebensmittel. Zum Beispiel über das „Rind als Klimasünder“. Begriffe wie „Laktose“ werden mit Unverträglichkeiten assoziiert, doch über die Aufgaben der Laktose im menschlichen Körper wird wenig erzählt. Das verunsichert.
Dem Superfood werden besondere Fähigkeiten und Nährstoffe zugeschrieben und beworben. Die Bevölkerung zahlt einen guten Preis für Produkte wie Chiasamen. Doch die regionalen Lebensmittel haben höhere Werte wie Transparenz und Herkunftsbezug. Zudem setzen die meisten Vitamine und Mineralstoffe erst bei der Reife ein. Werden Lebensmittel unreif geerntet und lange transportiert, liefern diese Lebensmittel nie so viele Nährstoffe wie die Lebensmittel aus der Umgebung, erklärt Fischer.
Medien, Berichte, Bücher und andere Informationsquellen transportieren viele negative Aspekte über die Lebensmittel. Zum Beispiel über das „Rind als Klimasünder“. Begriffe wie „Laktose“ werden mit Unverträglichkeiten assoziiert, doch über die Aufgaben der Laktose im menschlichen Körper wird wenig erzählt. Das verunsichert.
Dem Superfood werden besondere Fähigkeiten und Nährstoffe zugeschrieben und beworben. Die Bevölkerung zahlt einen guten Preis für Produkte wie Chiasamen. Doch die regionalen Lebensmittel haben höhere Werte wie Transparenz und Herkunftsbezug. Zudem setzen die meisten Vitamine und Mineralstoffe erst bei der Reife ein. Werden Lebensmittel unreif geerntet und lange transportiert, liefern diese Lebensmittel nie so viele Nährstoffe wie die Lebensmittel aus der Umgebung, erklärt Fischer.
Plattform für Ernährung: #dieEsserwisser
Katrin Fischer und Viktoria Hötzendorfer haben es sich zur Aufgabe gemacht Lebensmittelwissen weiterzugeben. Involviert sind Bäuerinnen und Bauern, die über die Lebensmittelproduktion berichten können, Seminarbäuerinnen die über den Umgang mit den Lebensmitteln aufklären und Ernährungswissenschaftler, die darüber berichten, was Lebensmittel mit dem Menschen machen. Über die Plattform www.esserwissen.at können Unterlagen gedownloadet werden, Infos über die unterschiedlichsten Lebensmittel nachgelesen oder Rezepte zu „kochen ohne Rezept“ gesucht werden. Interaktive Tools wie „Die Speis“ bereiten Wissen über die richtige Lagerung im Kühlschrank auf.
Auftrag: Erzeugung unserer Lebensmittel
„Ernährung geht uns alle an und gesunde, nachhaltig erzeugte Lebensmittel sind ein Beitrag zu Selbstversorgung und Klimaschutz“, so LK-Präsident Josef Moosbrugger abschließend. „Österreichs Landwirtschaft erzeugt Lebensmittel auf sehr hohem Niveau und wir sind in der glücklichen Lage, dass die Versorgung der Bevölkerung mit selbst erzeugten Lebensmitteln möglich ist. Dazu tragen im Getreidebereich insbesondere die Gunstlagen in Ostösterreich und im Milch- und Fleischbereich unsere Grünland- und Berggebiete bei.“
Vorarlberg ist kleinstrukturiert. Der durchschnittliche Betrieb hat 11 Hektar und hält, sofern er Milch erzeugt 18 Milchkühe. 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sind extensiv bewirtschaftete. 38.000 Hektar Alpen und 16.000 Hektar extensiv bewirtschaftete Wiesen werden durch unsere Tiere erhalten und gepflegt. Ergänzungsfutter stammt aus Resten der Lebensmittelerzeugung oder ist Futtergetreide, das in der Qualität nicht für Lebensmittel geeignet ist. Diese Lebensmittel gelangen durch die Tierhaltung wieder in den Lebensmittelkreislauf zurück. Das vielzitierte Beispiel des südamerikanischen Soja gibt es in unserer Milchwirtschaft nicht.
Und auch beim Klima sind wir besser als unser Ruf, wie Prof. Windisch eindrucksvoll berichtet hat. Unser Grünland mit acht Prozent Humusanteil weist eine hohe CO2-Speicherqualität auf. Wir dürfen also getrost stolz auf unsere Leistungen sein. Auch wenn es darum geht, eine klare Herkunftskennzeichnung zu fordern oder mit dem Lebensmittelhandel auf Augenhöhe in Verhandlung zu treten. Wir sind auch dort ein Teil der Lösung.
Vorarlberg ist kleinstrukturiert. Der durchschnittliche Betrieb hat 11 Hektar und hält, sofern er Milch erzeugt 18 Milchkühe. 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sind extensiv bewirtschaftete. 38.000 Hektar Alpen und 16.000 Hektar extensiv bewirtschaftete Wiesen werden durch unsere Tiere erhalten und gepflegt. Ergänzungsfutter stammt aus Resten der Lebensmittelerzeugung oder ist Futtergetreide, das in der Qualität nicht für Lebensmittel geeignet ist. Diese Lebensmittel gelangen durch die Tierhaltung wieder in den Lebensmittelkreislauf zurück. Das vielzitierte Beispiel des südamerikanischen Soja gibt es in unserer Milchwirtschaft nicht.
Und auch beim Klima sind wir besser als unser Ruf, wie Prof. Windisch eindrucksvoll berichtet hat. Unser Grünland mit acht Prozent Humusanteil weist eine hohe CO2-Speicherqualität auf. Wir dürfen also getrost stolz auf unsere Leistungen sein. Auch wenn es darum geht, eine klare Herkunftskennzeichnung zu fordern oder mit dem Lebensmittelhandel auf Augenhöhe in Verhandlung zu treten. Wir sind auch dort ein Teil der Lösung.
Weitere Termine „Die Kammer kommt in die Region“
- Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr: „Alp- und Weidewirtschaft vor neuen Herausforderungen“ Im Mittelpunkt steht der Wolf und die aktuelle Situation rund um das Großraubtier in der Schweiz und in Österreich mit FM DI Gregor Grill, LK Salzburg und Peter Küchler, Direktor Plantahof Schweiz. Onlinezugang ab 19.30 Uhr: t1p.de/kk2022-alp
- Dienstag, 15. Februar, 20 Uhr: „Biologische Wirtschaftsweise – was kommt Neues?“. Es geht mit DI Joachim Mandl, LK Oberösterreich um die neue EU-Bio-Verordnung. Florian Vincent, LK Vorarlberg gibt einen Überblick über die aktuellen Bio-Online-Anwendungen und DI Lukas Weber-Hajszan, BMLRT berichtet über Bio in der ländlichen Entwicklung. Onlinezugang ab 19.30 Uhr: t1p.de/kk2022-bio
- Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr: „Tierwohl und Lebensqualität gehören zusammen.“ Barbara Kathrein, Trainerin, Coach und Beraterin am bäuerlichen Sorgentelefon stellt den Zusammenhang her: „Geht’s mir gut, geht’s dem Tier gut, geht’s dem Betrieb gut.“ Hofberater Ing. Stephan Kopf von der LK Vorarlberg berichtet über Abkalbebereiche und Management rund um die Kalbung (es wird eine TGD-Stunde angerechnet; sie erfolgt automatisch mit der Registirierung üben den Zugangslink). Onlinezugang ab 19.30 Uhr: t1p.de/kk2022-tgd